Indiziert in
- RefSeek
- Hamdard-Universität
- EBSCO AZ
- Euro-Pub
- Google Scholar
Nützliche Links
Teile diese Seite
Zeitschriftenflyer
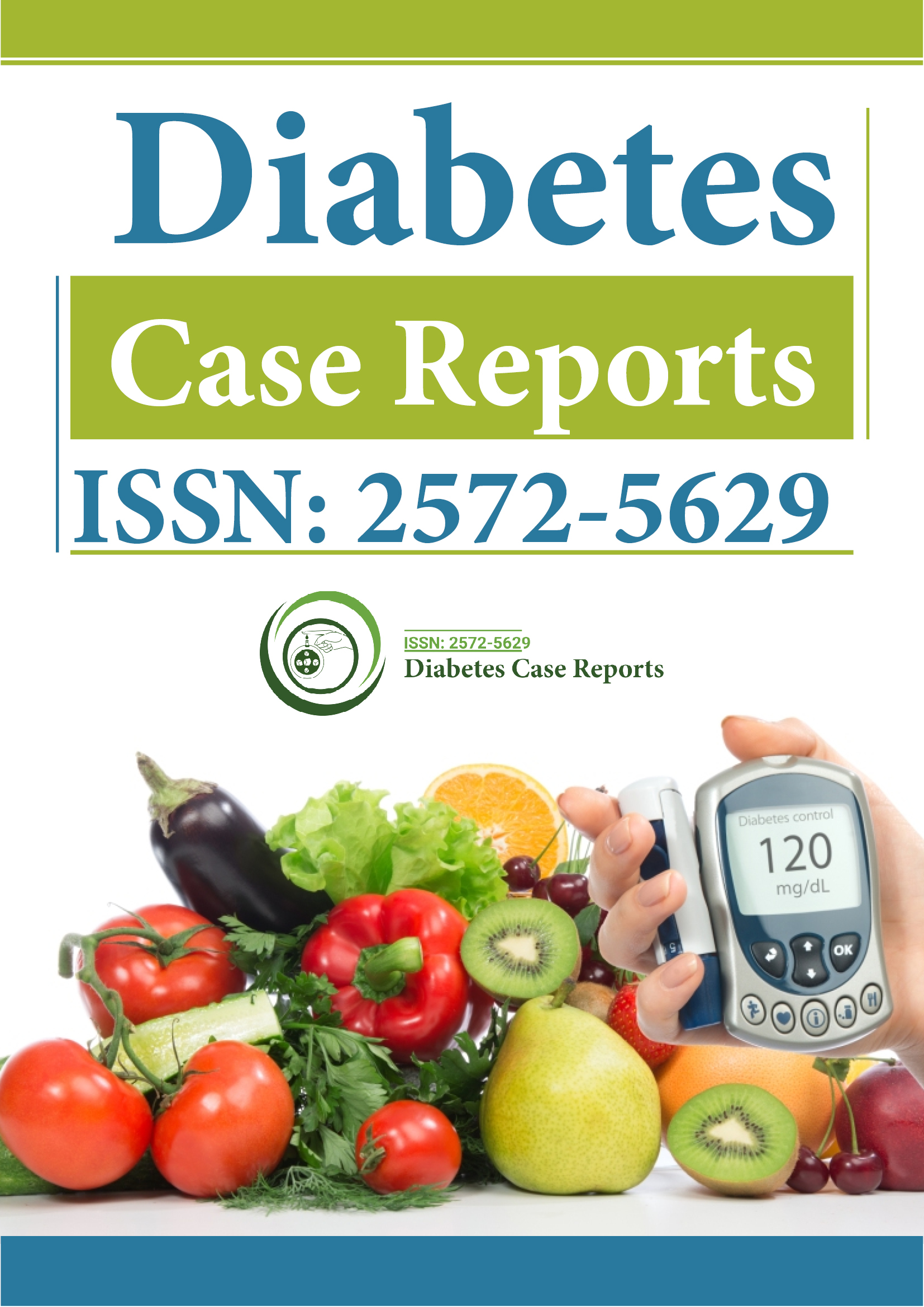
Open-Access-Zeitschriften
- Allgemeine Wissenschaft
- Biochemie
- Bioinformatik und Systembiologie
- Chemie
- Genetik und Molekularbiologie
- Immunologie und Mikrobiologie
- Klinische Wissenschaften
- Krankenpflege und Gesundheitsfürsorge
- Landwirtschaft und Aquakultur
- Lebensmittel & Ernährung
- Maschinenbau
- Materialwissenschaften
- Medizinische Wissenschaften
- Neurowissenschaften und Psychologie
- Pharmazeutische Wissenschaften
- Umweltwissenschaften
- Veterinärwissenschaften
- Wirtschaft & Management
Abstrakt
Entwicklung von GLP-1-Freisetzungsmitteln
Marco Falasca und Silvano Paternoster
Diabetes ist derzeit eines der größten Gesundheitsprobleme weltweit und nimmt sehr schnell zu, vor allem aufgrund seines starken Zusammenhangs mit Fettleibigkeit. Diabetes ist mit mehreren Komplikationen verbunden, darunter mikro- und makrovaskuläre Komplikationen, die hauptsächlich durch schlecht kontrollierte Blutzuckerwerte verursacht werden und letztlich zu einer verkürzten Lebenserwartung führen. Derzeit besteht ein großes Interesse an der Entwicklung neuer therapeutischer Strategien, um die Entwicklung und das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern und eine bessere Kontrolle des Blutzuckerspiegels zu gewährleisten. Inkretine, insbesondere Glucagon-ähnliches Peptid-1 (GLP-1), stimulieren die Insulinsekretion auf glukoseabhängige Weise. Der Inkretineffekt ist vermutlich für mindestens 50 % der postprandialen Insulinsekretion bei gesunden menschlichen Probanden verantwortlich, bei Patienten mit Typ-2-Diabetes ist er jedoch deutlich reduziert, was zumindest teilweise auf einen Mangel an mahlzeiteninduzierter GLP-1-Freisetzung zurückzuführen ist. Pharmakologische GLP-1-Analoga wurden zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen. Basierend auf unseren jüngsten Ergebnissen haben wir in dieser Studie die Hypothese untersucht, dass das Phospholipid Lysophosphatidylinositol (LPI) den Blutzuckerspiegel durch Stimulation der GLP-1-Freisetzung regulieren kann. Unser Gesamtziel ist es, festzustellen, ob LPI und/oder LPI-Analoga als blutzuckersenkende Mittel wirken können und ob Strategien zur Verstärkung der Freisetzung von endogenem GLP-1 durch diesen neuen LPI-abhängigen Mechanismus bei der Blutzuckerregulierung von Vorteil sein können. Diese Strategie wäre im Vergleich zu derzeit verfügbaren Therapien von Vorteil, da sie auf eine verstärkte Freisetzung von endogenem GLP-1 abzielt, anstatt auf die Verwendung von Mimetika zu setzen.